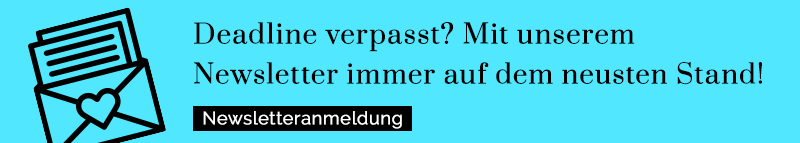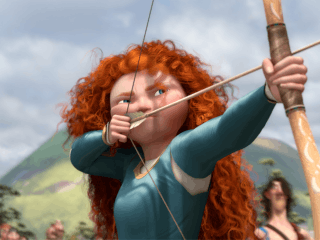Mode in der ersten Welle des Feminismus
Letzte Woche sind wir darauf eingegangen, wie Mode systematisch benutzt wurde, um Frauen physisch wie auch mental zu kontrollieren und einzuschränken. Heute drehen wir den Spieß um. Heute geht es darum, wie Frauen Mode für sich nutzten. Denn Kleidung kann nicht nur Instrument zur Unterdrückung sein, Kleidung hat auch das Potenzial herrschende Ordnungen aufzubrechen.
Wie wir bereits erklärt haben, gab es drei Wellen des Feminismus. In diesem Artikel wird es um die erste Welle gehen, die im 19. Jahrhundert durch die Suffragetten ausgelöst wurde und in den 1920er Jahren ihr Ende fand.
Suffragetten waren so etwas, wie die ersten Feministinnen. Sie setzten sich nicht nur mit ihren Worten für mehr Rechte ein, sondern ließen vor allem Taten sprechen. So schreckten sie nicht davor zurück, Fensterscheiben mit Steinen einzuschlagen oder Brand zu stiften. Doch so skrupellos sie auch waren, so viel Wert legten sie auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Suffragetten passten sich den damaligen Schönheitsidealen und Modetrends an, denn sie wollten mit ihren Outfits nicht von ihrem Anliegen ablenken. Außerdem hatten sie vom Negativbeispiel gelernt: Frauenrechtsaktivistin Amelia Bloomer führte 1851 einen neuen Trend ein – eine lockere Tunika, die über weiten Hosen getragen wurde – die Hosen wurden später als Bloomers bekannt. Dieser Trend war wie ein Geschenk für die Medien, sie entwickelten einen Cartoon der stereotypischen Feministin: Eine willensstarke Frau mit maskulinen Klamotten, dicken Brillengläsern und Galoschen. Von diesem Klischee wollten sich die Suffragetten so weit wie möglich entfernen, denn sie wussten, dass ihre beste Chance, das Frauenwahlrecht zu erlangen, darin bestand, sich zumindest nach außen hin anzupassen, um einen Affront zu vermeiden. Sie kleideten sich also in der damals typischen, “edwardian” Fashion: hoch geschlossene Blusen unter Kleidern, reich an Spitzenverzierungen und Stickereien, große Hüte und natürlich das S-Curve-Korsett, das den Körper in
eine S-Form zwängte. Eine große Rolle spielten allerdings die drei Farben, mit denen sie sich identifizierten: Violett stand für Loyalität und Würde, Grün für die Hoffnung und Weiß für Reinheit. Mithilfe dieser Farben schafften sie es nach außen hin eine starke Präsenz und eine vereinte Front zu zeigen. Suffragette zu sein galt bald als schick und modern und sogar die großen Kaufhäuser, wie Selfridges boten Schleifen, Broschen und Hutbänder in ihren Farben an.
Doch bevor das Ziel der Suffragetten – das Wahlrecht für Frauen – erreicht wurde, kam der Erste Weltkrieg und veränderte alles. Männer gingen an die Front und Frauen nahmen ihre Plätze in der Arbeitswelt ein. Diese neuen Umstände erforderten eine neue Mode. Kleidung musste praktischer werden, damit Frauen in ihrem Arbeitsalltag freier und beweglicher waren. So wurden auch Kleidungsstücke wie Hosen oder Overalls zum ersten Mal für Frauen zugänglich, wenn es der Job erforderte – zuvor wäre das nicht nur ein Skandal gewesen, man hätte sogar dafür verhaftet werden können! Mode wurde schlichter, hatte weniger Verzierungen, Röcke wurden kürzer und Farben dunkler – ein Resultat der geringen Verfügbarkeit der Materialien.
Diese Herausforderungen machte sich die Designerin Coco Chanel zunutze, sie ging auf die neuen Bedürfnisse der Frauen ein und spielte somit eine große Rolle in der Evolution der Mode. Sie ließ viele Elemente aus der Herren- und Sportbekleidung in die Damenmode einfließen und revolutionierte diese. Ihre Styles zeichneten sich durch den Gebrauch von Jerseystoffen aus, Komfort stand bei ihren Designs im Vordergrund. Sie entwarf Hosen für Frauen, designte schlichte, locker geschnittene Kleider und verhalf damit Frauen zu mehr (Bewegungs-)Freiheit. Doch diese neue Freiheit war auch ein Resultat des Kriegs – Frauen fuhren Autos, gingen zur Arbeit und verdienten gutes Geld. Langsam wurden die traditionellen Genderrollen aufgebrochen. Die Frau hatte einen kleinen Vorgeschmack von Gleichberechtigung bekommen.
Doch diese scheinbare Gleichberechtigung sollte nicht lange währen. Der Krieg ging zu Ende und die Männer kamen nach Hause, in der Erwartung in ihre alten Jobs zurückzukehren. Frauen waren gezwungen, wieder ihren Platz am Herd einzunehmen. Doch einige Veränderungen konnte man nicht mehr rückgängig machen. Die Frau hatte sich an die neuen Freiheiten gewöhnt und wollte diese auch so schnell nicht mehr abgeben: Frauen fuhren Autos, sie tranken Alkohol, rauchten Kette, flirteten ohne Scham und tanzten unbändig – es waren die Goldenen Zwanziger. Außerdem hatten Frauen in einigen Ländern bereits das Wahlrecht. Und obwohl ihnen vorgeworfen wurde, sie seien egozentrisch, apolitisch und nur am Feiern und den schönen Dingen interessiert, schaffte es grade dieses unbekümmerte Verhalten Grenzen zu sprengen. Denn die sogenannten Flappers stellten ihre persönlichen Limits auf die Probe. Sie forderten, ihre Sexualität genauso ausleben zu können, wie Männer. Und durch die neue Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln war dies auch zum ersten Mal möglich. Die Mode wurde immer freizügiger, die Röcke kürzer und die Kleider androgyner. Denn Korsetts wurden langsam durch Seidenbandeaus, die den Busen abflachten, ersetzt. Anstatt die Taille zu betonen, rutschte diese immer weiter nach unten und Kleider waren gerade und locker geschnitten. Frauen entkamen nicht nur körperlichen Zwängen, sondern auch sozialen. Sie trotzten traditionellen Erwartungen der Gesellschaft und schafften es so ihre Freiheiten immer mehr auszuweiten.
Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Josephine Baker spiegelt in ihrem freizügigen Bühnenoutfit den Zeitgeist der 20er Jahre wieder. Sie war unerschrocken, mutig und lebte ihre Sexualität in freien Zügen aus.
Nächste Woche knüpfen wir an dieser Stelle an. Es wird um starke Frauen, wie Marlene Dietrich gehen und darum, was für eine Auswirkung Diors New Look auf die Frauenbewegung hatte. Bleibt dran!